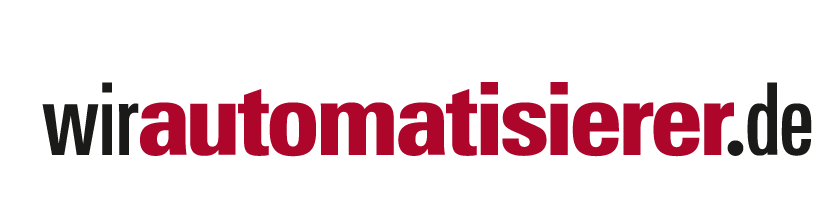Die digitale Durchgängigkeit von der Produktentwicklung bis in die Fertigung ist eines der Themen, die im Zusammenhang mit Industrie 4.0 sicher an Relevanz zulegen werden. Dem Automatisierer bieten sich – gerade bei steigendem Softwareanteil in Maschinen und Anlagen – zahlreiche Chancen bis hin zu Potenzialen der M2M- und interessanterweise auch Mensch-Maschine-Kommunikation. Ein möglicherweise entscheidender Apekt auch bei der Modernisierung älterer Anlagen.
Inhaltsverzeichnis
1. Modellbasierte Entwicklung bis hin zum SPS-Code
2. Direkt mit den Maschinen sprechen
3. Offene Standards für Industrie 4.0
Die inflationäre Verwendung des Begriffes Industrie 4.0 verstellt gerne den Blick darauf, dass dahinter vor allem die technischen Möglichkeiten der Kommunikationstechnologie und des Softwareeinsatzes stehen. Kein leichtes Thema für viele Maschinen- und Anlagenbauer – machen Sie doch die Erfahrung, dass dazu weit mehr Abstimmung und Koordination erforderlich ist bis hin zur disziplinübergreifenden Zusammenarbeit (der sich die Schwesterzeitschrift develop3 systems engineering in der Konradin Mediengruppe widmet). Eine wesentliche Rolle spielt natürlich die Verwendung digitaler Modelle. Auch der Arbeitsplatz des Automatisierers verändert sich – zu erkennen vor allem am steigenden Softwareanteil in Maschinen und Anlagen. Die Automatisierung baut damit ihre Stellung als Enabler-Technologie aus.
Die VDI/VDE-Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) sieht in ihrem Papier ‚Automation 2025 – Thesen und Handlungsfelder‘, vorgestellt im Rahmen des VDI-Kongresses Automation in Baden-Baden, die Automation als Bindeglied zwischen den Elementen der realen Welt und ihren virtuellen Abbildern in Simulation, Überwachung und Steuerung. „Sie generiert aus den Möglichkeiten der Software realen Nutzen – sei es in der Ressourcenschonung oder der altersgerechten Gestaltung von Arbeitsumgebungen“, sagt Dr. Kurt D. Bettenhausen, Vorsitzender der GMA. Automation sei notwendig, um dem demografischen Wandel, der Globalisierung, der wachsenden Komplexität und der geforderten Flexibilität mit konkreten Lösungen für die produzierende Industrie zu begegnen.
Zwei wesentliche Herausforderungen gilt es jedoch laut GMA zu meistern, die nicht durch die technischen Disziplinen allein gelöst werden können:
- Die Schaffung einer durchgängigen IT-Sicherheit sowie
- global gesetzliche Rahmenbedingungen, um den immer stärker vernetzten Unternehmen Rechtssicherheit zu garantieren.
„Wenn Wertschöpfungsketten, Produkte und Dienstleistungen miteinander hochgradig vernetzt werden, müssen nicht nur für kritische Infrastrukturen Lösungen für die IT-Sicherheit geschaffen werden“, so Bettenhausen weiter. „Und für global agierende Unternehmen, aber auch für kleinste Zulieferer, können nationale Gesetze keine Lösung darstellen – selbst europäische Gesetze greifen nicht weit genug.“ Auch die internationale Normenlage sei kaum überschaubar, zum Teil widersprüchlich und enthalte Lücken. „Die gesamte Landschaft muss analysiert und international müssen Schutzmaßnahmen abgeleitet werden.“
Betrachtet man speziell die Digitalisierung aus Sicht der Produktentwickler, stellt man fest, dass eine modellbasierte Entwicklung – die Modellbildung von Maschine und Funktionalität, die Simulation des Zusammenspiels und die anschließende automatische SPS-Code-Generierung – an sich nichts Neues ist, wie Philipp Wallner, Industry Manager bei Mathworks betont. „Sie begegnet aber sehr effizient den größten Herausforderungen im Maschinenbau!“ Der Maschinen- und Anlagenbau entwickele sich weltweit immer mehr zu einer mechatronischen Disziplin, bei der nicht nur die drei Domänen Mechanik, Elektrik und Software enger zusammenarbeiten müssten, sondern bei der auch die Software oder die Maschinenapplikation einen zunehmend bedeutenderen Anteil einnehme. „Für den europäischen – speziell auch für den deutschen Maschinenbau – sehen wir immer noch ein enormes Verbesserungspotenzial, modellbasierte Entwicklung einzusetzen, um sich durch höhere Produktionsqualität und Maschineneffizienz einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und die Entwicklungszeit weiter zu verkürzen.“
Das Wissen um die Modellierung mechatronischer Systeme und um Software-Design sei in den klassischen Maschinenbauunternehmen allerdings immer noch sehr spärlich vorhanden, so Wallner weiter. „Es reicht auch nicht aus, sich das Thema Industrie 4.0 einfach nur auf die Fahne zu heften.“ Um es tatsächlich im Unternehmen zu verankern, benötige man auch die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Entwicklungsworkflows und die richtigen Tools – was dann aber auch die Chance böte, neue Geschäftswege zu beschreiten: „Maschinen und Anlagen haben heute eine Lebensdauer von 20 Jahren und mehr, in denen sie meist rund um die Uhr im Einsatz sind – das wird sich auch in Zukunft nicht ändern“, erläutert Wallner. „Die Verlagerung von kritischer Funktionalität in die Software ermöglicht jedoch eine zusätzliche Flexibilität, Maschinen auch während des laufenden Betriebs nachzurüsten.“ Ein neuer Softwareregler könne eingesetzt werden, ohne dass die Anlage angehalten oder umgebaut werden müsse. „Langfristig werden wohl nur jene Maschinenbauer wettbewerbsfähig sein, die das Thema Industrie 4.0 ernst nehmen und die in der IT bereits bewährten Möglichkeiten in ihr eigenes Produktdesign und ihre Entwicklungsworkflows einbauen.“
Speziell die Robotik verdeutlicht dabei, welche Bedeutung der modellbasierten Entwicklung zukommen kann, denn: Immer anspruchsvollere Aufgaben erfordern immer komplexere Systeme. Im Projekt ‚D-Rock‘ entwickelt deshalb das Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) ein Software-Framework, das durch Modellierung und Modularisierung den Aufbau und den Betrieb leistungsstarker und zuverlässiger Robotersysteme ermöglichen soll. Ein entscheidender Vorteil der Modularisierung ergibt sich dabei durch die Wiederverwendbarkeit von Komponenten.
Bereits 2009 entwickelten die Forscher das Robotics Construction Kit (Rock), ein Software-Framework, das nach dem Baukastenprinzip modulare Tools zur Programmierung von Robotern bereitstellt. Das Anfang Juni 2015 gestartete Vorhaben D-Rock – vom BMBF im Projektträger Softwaresysteme und Wissenstechnologien (PT-SW) des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) über drei Jahre und mit 2,5 Millionen Euro gefördert – baut darauf auf. Das Besondere an D-Rock ist neben der Modularisierung der umfassende modellbasierte Ansatz, der die Komplexität der Software für den Programmierer handhabbarer macht. Die Modelle beschreiben nicht nur, wie einzelne Komponenten eingesetzt werden können; sie ermöglichen auch deren automatische Verwaltung. Neben der Software umfasst die Modellierung zudem die Hardware und das Verhalten der Systeme. Das Systemverhalten wird auf die Software abgebildet und diese wiederum auf die Hardware. Bei der Ausführung der Software wird der Systemzustand dann mit den Modellen abgeglichen – auf diese Weise sei eine dynamische Rekonfiguration des Systems möglich und der Roboter könne deutlich flexibler auf unvorhergesehene Situationen reagieren, so die DFKIler. Als Ergebnis des D-Rock Projektes soll dann ein Satz von Softwaretools zur Verfügung stehen, der das Rock-Framework erweitert. Die Effektivität des Ansatzes wird anhand des im DFKI-Projekt Limes entwickelten Roboters Mantis in einem Szenario aus der Darpa Robotics Challenge – einem internationalen Robotikwettbewerb zur Förderung und Entwicklung von Technologien, die bei Rettungseinsätzen zum Einsatz kommen – demonstriert. Mantis selbst ist ein sechsbeiniger Roboter, der die vorderen Extremitäten auch zur Manipulation verwenden kann.
Noch einen Schritt weiter gehen Forscher am Lemgoer Institut für industrielle Informationstechnik (init) der Hochschule OWL. Mit Smartphones könne man via Spracherkennung schon ‚sprechen‘ – warum nicht auch mit Maschinen in Industrieanlagen? fragen sie mit Blick auf eine Entlastung des Bedienpersonals der zunehmend komplexer werdenden industriellen Anlagen. Dazu wurde bereits eine Software entwickelt, mit der man Maschinendaten und Systemfehler erfragen beziehungsweise abrufen kann. „Dafür haben wir maschinenspezifische Kenntnisse in ein intelligentes System integriert und eine semantische Beschreibung – gewissermaßen Metainformationen – ermöglichen es dem Computer, Prozessdaten zu verarbeiten und zu vereinfachen“, erläutert Prof. Oliver Niggemann, Vorstandsmitglied am init.
Forschungsziel des Projektes ‚Semantics4Automation‘ ist nun die Entwicklung einer Wissensbasis, die dem Menschen eine abstrakte Kommunikation mit der Maschine ermöglicht. Dazu wird formalisiertes Wissen über die Domäne in einer Ontologie modelliert. Maschinen können auf diese Weise auf ein sogenanntes Ontologiemodell zurückgreifen, um neue Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu erlangen. Dazu werden Algorithmen, beispielsweise zur Analyse und Diagnose, mit der Ontologie gekoppelt. Die Anlage ist damit selbstständig in der Lage, einen Algorithmus für eine Fragestellung zu wählen. Durch das vorhandene Wissen aus der Ontologie können die Ergebnisse der Algorithmen geprüft und bewertet werden. Soll zum Beispiel der aktuelle Zustand einer Anlage ermittelt werden, soll die Maschine selbstständig zwischen normalem und anormalem Verhalten unterscheiden können – damit muss der Mensch für die Bedienung der Anlage kein spezielles Maschinenwissen mehr haben. Über ein Assistenzsystem kann aber ein Mitarbeiter die komplexen Informationen direkt von der Maschine erhalten, beispielsweise auf ein Tablet, eine Smartwatch oder einen PC. Am init entstand dazu ein Demonstrator mit Nutzerschnittstelle, dem Fragen oder Befehle per Eingabe über eine Tastatur gestellt werden können. Die Eingabe in den Demonstrator kann frei formuliert werden. So kann der Benutzer aktuelle Werte und Komponenten des Systems abfragen – etwa zu Temperatur oder Energieverbrauch einer Anlage. Das System antwortet ebenfalls mit einer Bildschirmausgabe.
Darauf aufbauend will man nun noch einen Schritt weiter gehen und arbeitet an Lösungen mit Spracherkennung. „Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu vereinfachen, vor allem für Personen ohne technische Vorkenntnisse“, so Niggemann weiter. „Die Vision dahinter: Jeder Mitarbeiter kann später mit einer industriellen Maschine sprechen und interagieren.“ Dabei sollen nicht nur Werte abgefragt werden, sondern auch Warum?-Fragen zur Feststellung von Anomalien möglich sein. Möglich ist das, weil eine Vielzahl von Algorithmen die Anlage überwacht und Anomalien erkennt. Die Ergebnisse werden mit Hilfe einer Wissensbasis ausgewertet, um eine Antwort zu erstellen. „Als Wissensbasis wird eine Ontologie verwendet, weil die Maschine nicht ‚weiß‘, was für uns Menschen klar ist.“ Geht es nach den Lemgoer Forschern, kann eine Maschine bald Informationen hinterfragen. Auf die Frage ‚Wie hoch ist die Drehzahl des Motors?‘ könnte die Nachfrage lauten: ‚Welchen Motor meinen Sie?‘. Über diese Spezifizierung können die Fragen wesentlich genauer beantwortet werden. „Wir planen erste Piloteinsätze in der SmartFactoryOWL für 2016, fährt Niggemann fort. „Langfristiges Ziel ist eine Standardisierung und gemeinsame Kommunikationssprache zwischen Maschinen, damit möglichst viele Geräte von dem System profitieren können.“
Neben dem hochgesteckten Ziel einer Sprachverständigung von Mensch zu Maschine und umgekehrt bleibt allerdings weiter auch die Frage interessant, wie Informationen auf technischer Ebene in komplexen, großen Fertigungsnetzwerken am besten auszutauschen sind. Daran arbeitet intensiv die Technologie-Initiative SmartFactoryKL e.V. zusammen mit Bosch Rexroth. Ziele sind die Weiterentwicklung der herstellerübergreifenden Industrie-4.0-Demonstrationsanlage und die Etablierung herstellerübergreifender Konzepte mittels offener Standards in serviceorientierten Architekturen.
Aktuell arbeiten die Wissenschaftler und Entwickler verschiedener Unternehmen an der Umsetzung einer modularen Fertigung basierend auf offenen Standards und serviceorientierten Architekturen (SOA). Der Einsatz offener Standards, wie zum Beispiel OPC UA und MQTT (Message Queue Telemetry Transport), ermöglicht das Zusammenspiel zwischen Komponenten unterschiedlicher Hersteller. Maschinenbauer können dadurch einfacher die eingangs erwähnten modularen Maschinenkonzepte realisieren. Durch den modularen Aufbau von Softwarekomponenten mittels SOA können Dienste von Maschinen besser ausgetauscht, gewartet und erweitert werden. co
Link zum VDI/VDE-GMA-Papier: